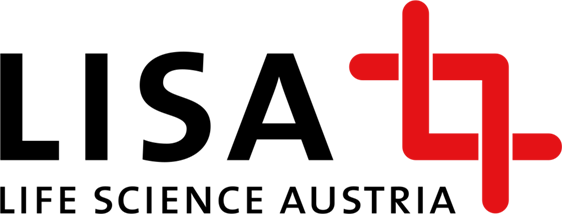Wie man die Epidemie berechnen kann
So funktionieren die Computermodelle, die von der TU Wien und ihrem Spinoff-Unternehmen dwh entwickelt wurden.
An Prognosen und Hochrechnungen zur COVID-19-Ausbreitung herrscht kein Mangel. Allerdings sollte man hier vorsichtig sein: Einfach die bisher nachgewiesenen Krankheitsfälle Tag für Tag mit einem bestimmten Faktor zu multiplizieren, um ein exponentielles Wachstum zu simulieren, ist noch lange kein sinnvoller Blick in die Zukunft. Wenn man realistische Einschätzungen haben möchte, braucht man kompliziertere Methoden.
An solchen Methoden arbeitet das Team von Niki Popper seit Jahren – am Institut für Information Systems Engineering der TU Wien und beim TU-Spinoff-Unternehmen dwh. Im Rahmen des COMET-Projekts „DEXHELPP“ sind auch einige andere Partnerorganisationen an der Forschungsarbeit beteiligt.
Wir und unser digitaler Zwilling
Dabei entstehen keine Hochrechnungen, sondern komplexe Simulationen: „Es gäbe natürlich mathematische Gleichungen, mit denen sich die Ausbreitung einer Epidemie in der Bevölkerung beschreiben lässt – zumindest in einem gewissen Rahmen“, sagt Niki Popper. „Aber unser Zugang ist viel flexibler. Wir arbeiten mit einem agentenbasierten Ansatz. Das heißt, wir simulieren das Verhalten vieler einzelner Menschen und können am Computer beobachten, wie diese virtuellen Agenten das Virus untereinander weitergeben.“
Reale Personen werden also durch „digitale Zwillinge“ am Computer repräsentiert und über den gesamten zeitlichen Verlauf der Epidemie hinweg verfolgt. Die virtuelle Person legt jeden Tag bestimmte Wege zurück – etwa zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause. Simuliert wird Tag für Tag, welche Person welche Kontakte zu welchen anderen Personen hat.
Dadurch ergeben sich dynamische Netzwerke: Es gibt Menschen, mit denen eine Person regelmäßig Kontakt hat, etwa im Haushalt oder am Arbeitsplatz. Dazu kommt wechselnder Kontakt mit zufälligen Personen – etwa mit Kund_innen im Geschäft. Bei jedem einzelnen virtuellen Kontakt gibt es eine bestimmte Ansteckungswahrscheinlichkeit. So ergibt sich unter normalen Bedingungen zu Beginn eine exponentielle Ausbreitung der Infektion – nicht, weil man Exponentialfunktionen verwendet hätte, um die Epidemie zu beschreiben, sondern als natürliche Konsequenz des Modells, als Ergebnis der simulierten Zufallskontakte.
Daten, Daten, Daten
Berücksichtigt wird eine breite Palette von Bevölkerungsdaten. So ist etwa die Altersverteilung von entscheidender Bedeutung, weil sie einen wichtigen Einfluss auf die Zahl der Kontakte hat. Auch das Geschlecht und die genau räumliche Verteilung der Wohnorte ist wichtig. Im ländlichen Raum hängt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine andere ansteckt, stark vom räumlichen Abstand ihrer Wohnsitze ab. In einer Großstadt wie Wien ist dieser Zusammenhang schwächer, weil es dort eher die Möglichkeit besteht, sich über rein zufällige Kontakte anzustecken, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln.
„Viele unserer Daten haben wir von der Statistik Austria – etwa über die Größe der Haushalte, die regionale Bevölkerungsverteilung oder die Verteilung und Größe der Arbeitsplätze“, erklärt Martin Bicher (dwh). „Außerdem gibt es viel wissenschaftliche Literatur, die wir in unseren Modellen berücksichtigen – von der typischen Kontaktwahrscheinlichkeit pro Aufenthaltsort bis zu Abschätzungen über Ansteckungswahrscheinlichkeiten.“
Wenn man all das berücksichtigt, kann man simulieren, wie sich Quarantänemaßnahmen, Veranstaltungsverbote oder Schulschließungen auswirken. „Solche Maßnahmen verändern schlagartig die Struktur der Kontaktnetzwerke – und wir sehen in unseren Modellen sehr deutlich, dass sich das auch auf die Ausbreitung der Krankheit auswirkt“, erklärt Martin Bicher.
Nachrechnen, ob die Ressourcen ausreichen
Wichtig ist nun vor allem, dass die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten werden kann. Welche Maßnahmen dafür nötig sind, lässt sich mit den agentenbasierten Computermodellen ebenfalls einschätzen: „Im Modell wird zwischen milden, schweren und kritischen Fällen unterschieden, die jeweils unterschiedliche Betreuung brauchen“, sagt Niki Popper. Die altersabhängige Verteilung des Schweregrades wurde dabei aus einer Fallzahlenstudie aus China übernommen und auf die österreichische Bevölkerungsstruktur umgerechnet. Die Anzahl von Krankenhausbetten und Intensivversorgungsbetten wird ebenfalls in der Modellierung berücksichtigt, um anhand verschiedener Szenarien untersuchen zu können, ob die Ressourcen ausreichen.
„Wir sind ständig dabei, unsere Modelle zu verbessern und zu verfeinern“, sagt Niki Popper. „Immer wieder kommen neue Erkenntnisse dazu, die wir berücksichtigen können. So hoffen wir, in nächster Zeit Schritt für Schritt immer genauer sagen zu können, wie sich COVID-19 entwickeln wird. Dass sich nun die meisten Leute in Österreich an die Quarantäne-Empfehlungen zu halten scheinen, stimmt uns jedenfalls optimistisch.“